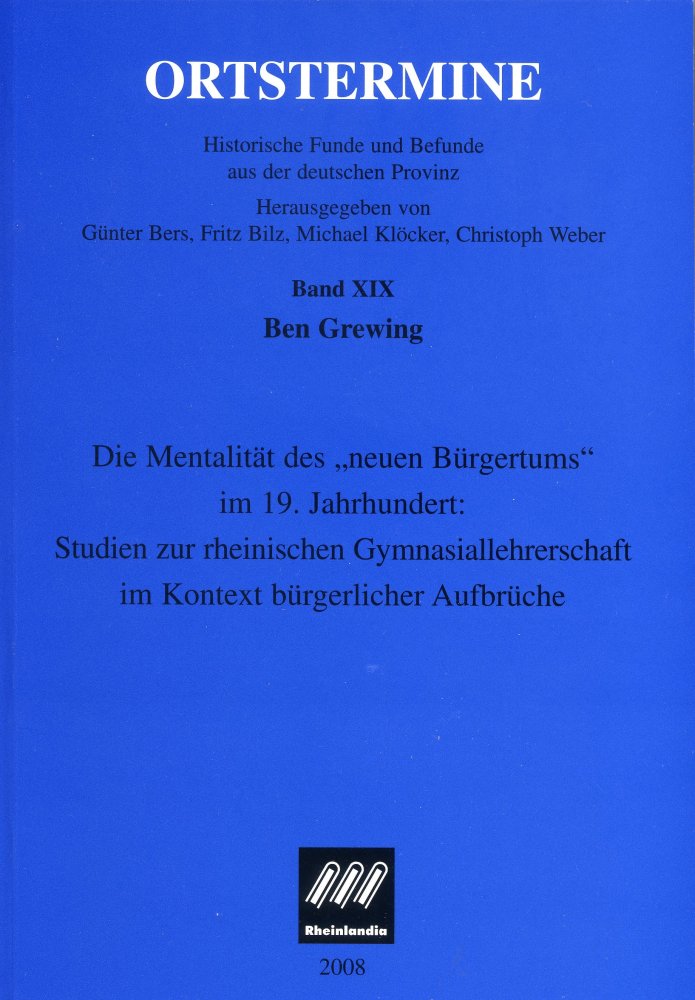 Die Mentalität des "neuen Bürgertums" im 19. Jahrhundert: Studien zur rheinischen Gymnasiallehrerschaft im Kontext bürgerlicher Aufbrüche
Die Mentalität des "neuen Bürgertums" im 19. Jahrhundert: Studien zur rheinischen Gymnasiallehrerschaft im Kontext bürgerlicher Aufbrüche
Rheinische Gymnasiallehrer des 19. Jahrhunderts waren als eine kleine,
aber wesentliche Gruppe am bürgerlichen Selbstfindungsprozess im Rheinland beteiligt. Mit ihrem Unterricht
und ihrer Erziehung schufen sie zum einen das Gymnasium als eine der wichtigsten Bildungseinrichtungen des
Bürgertums im Rheinland. Durch ihre Haltung, ihr Verhalten und ihre Mentalität prägten sie
zugleich ihre Schüler, zumeist Söhne des Bürgertums, entscheidend. Dabei bildete die
Mehrheit der Gymnasiallehrerschaft erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts eine berufliche Gruppe mit
deutlicheren Konturen, die dann auch zunehmend Überschneidungen mit der Mentalität des Bürgertums
aufwies.
Für eine große Gruppe der rheinischen Gymnasiallehrer wurde während des 19. Jahrhunderts
eine Aufstiegsorientierung zum besonderen Merkmal ihrer Mentalität. Dennoch war die Zusammensetzung
der Gymnasiallehrerschaft als eine Teilgruppe des Bürgertums im Rheinland sehr heterogen.
Denn nicht alle Lehrer teilten die Aufstiegsorientierung, und andere scheiterten bei dem Versuch, sich zu
verbessern. Auslöser für die Aufstiegsorientierung war in den meisten Fällen eine Herkunft
aus dem mittleren Bürgertum und aus dem Kleinbürgertum. Besonders im Heiratsverhalten von
Gymnasiallehrern zeigte sich diese Aufstiegsorientierung. Im Gesellschaftsaufbau des
Rheinlandes im 19. Jahrhundert zeigt die Gruppe der Gymnasiallehrer eine große vertikale Verteilung.
An der Spitze der Status-Skala standen Direktoren, am Ende technische Lehrer. Die einen wuchsen in
bildungsbürgerliche Kreise hinein, die anderen blieben dem Kleinbürgertum verhaftet.
Der Konflikt zwischen hehren Ansprüchen und hohen Erwartungen einerseits und der ernüchternden
realen Lebenssituation andererseits bildet das Zentrum der Mentalität rheinischer Gymnasiallehrer.
Diese Mentalität war einerseits von dem Versuch geprägt, bürgerliche Ideale wie Familiensinn,
sittsame Lebensführung, Heimatverbundenheit sowie Kunst-, Kultur- und Bildungsbeflissenheit zu
verwirklichen. Andererseits erforderte eine karge materielle Ausstattung eine eingeschränkte und
vorsichtige Lebensführung. Sparsamkeit, Verzicht, Gratifikationsaufschub, Zurückgezogenheit im
Umgang oder sogar Steifheit im Auftreten sind so ebenso zu Merkmalen der Mentalität von Gymnasiallehrern
geworden wie eine Liebe zum Formalen. Von den Möglichkeiten der Selbstdarstellung, wie sie
wirtschaftsbürgerlichen Kreisen oder Teilen des gut situierten Bildungsbürgertums zur
Verfügung standen, war die Mehrheit der Gymnasiallehr weit entfernt.
Dieser Titel kann über den Buchhandel oder
direkt beim Rheinlandia Verlag bestellt werden.